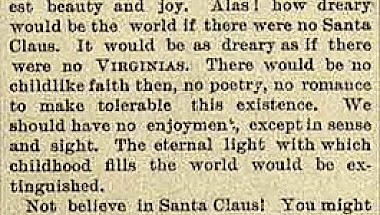Sieben Monate mit Theo
Es gibt Menschen, die ihre eigentliche Geschichte hinter sich haben.

Was immer nun noch folgt, es kommt zu spät, zählt nicht mehr, wäre nicht mehr nötig gewesen. Bei Schauspielern kann das einen Charakter ausmachen, der in der ersten Einstellung bereits alles über sich sagt. Bogart war so einer. Manche Maler verstehen es, den Portraitierten sich ganz Preis geben zu lassen. Bei Menschen, denen wir begegnen, kann das interessant und geheimnisvoll sein oder bloß schrecklich.
Auch U-Bahn-Stationen verändern sich. Manches, wie der Geruch nach frisch Erbrochenem unter dem Stephansplatz, scheint sich ewig zu halten. Anderes ist ständig im Wandel, Stationen wechseln ihre Bewohner, vielleicht ohne Anlass, vielleicht, weil ein Zusammenleben nie einfach ist. Die Station, die ich täglich durchquere, um kurz ans Licht des Tages und gleich danach in die künstlichen Lichtfluten meines Büros zu steigen, ist riesig. Endlos wirkende weiße Gänge führen zu den bewegten Treppen, ohne die uns Stiegen wie Zumutungen erscheinen. An den Ausgängen, die oben, im Freien, so weit voneinander entfernt sind, als brauchte man ein weiteres Verkehrsmittel, um von einem zum andern zu gelangen, haben sich einige von denen eingenistet, für die es keine Bänke mehr gibt. Sie lungern in Gruppen, stehen und hocken, und frühmorgens schon ist kein Grausen mehr da vor dem, was das Grauen verdrängt, dem Fusel aus Tetrapackungen, die den Älteren unter ihnen vor langer Zeit einmal Sunkist oder Kakao bedeutet haben müssen. Die pyramidenförmigen Erinnerungen an andere Zeiten sind leichter stapelbaren Formen gewichen, und ihr Inhalt Reben, die nicht mehr süß sein wollen.
Am Ende eines jener Gänge befinden sich anachronistische Relikte einer weniger mobilen Zeit: Telefonzellen, die keiner mehr braucht, um den anderen zu erreichen. Ich erinnere mich daran, wie die Telefonhäuschen auf den Straßen Wiens zu offenen Kojen mutierten, Kälte, Wind und Lärm ausgesetzt, um den Unterstandslosen keine geschützten Nachtquartiere mehr zu bieten. Wie um einen späten Triumph zu feiern, haben die heutigen Nomaden der Großstadt die nutzlos gewordenen Nischen okkupiert, feiern darin ihre tristen Rituale und schlafen manchmal an die Wände gelehnt im Stehen, endlich erlöst von einigen Stunden, in denen sie nichts versäumen können.
Die Kolonie der Erniedrigten in meiner U-Bahn-Station ist multikulturell. Es gibt die, denen man anmerkt, dass sie einmal bürgerlich zu leben bestrebt waren, und jene, die das vielleicht nie wollten. Punks und schlicht Abgewrackte in den verschiedenen Stadien der Aufgabe teilen ihre Zone der Unberührbarkeit wie ihre Behältnisse an Flüssigkeiten. Manchen ist noch anzumerken, dass sie nun lieber unsichtbar wären, aber die meisten spielen den Part, den ihnen ihr Leben verpasst hat, mit der Würde von Schauspielern in undankbaren Nebenrollen.
Vor etwas mehr als sieben Monaten fiel mir morgens einer auf, der dort nicht hingehörte, und vor allem nicht dazu. Er durchstreifte langsam die Eingeweide der U-Bahn, aber er wirkte nur etwas verloren, nicht, als wäre er es schon. Ich nannte ihn nach einigen Tagen bei mir Theo, weil er mich an den Bruder von Vincent van Gogh erinnerte, aber an Vincent natürlich auch. Er war wohl in dem Alter, in dem viele von uns endlich einiger Maßen zu verdienen beginnen und an den ersten Neuwagen denken, hatte struppiges, widerspenstiges braunes Haar, war fast dürr, einfach aber sauber gekleidet und selbst nicht ungepflegt. Sein schleppender Schritt verriet, dass er die Ausgänge aus den Schächten nicht wirklich suchte, und seine Augen waren zumeist verquollen wie die eines Boxers oder eben nach einer Nacht auf der Suche nach sanfter Besinnungslosigkeit.
Theo hielt sich von den anderen fern, er schlurfte nur müde seine Runden durch die Gänge und unterirdischen Plätze einer Haltestelle, die ihm ein Kopfbahnhof geworden war. Mit den Wochen, in denen wir einander fast täglich begegneten, wurde daraus eine Endstation.
Bei manchen dauert der Abstieg Jahre, andere steigen nicht, sondern stürzen. Theo gönnte sich sieben Monate. Irgendwann war es ihm nicht mehr möglich, seine Kraft in das Ordnen und Reinigen seiner Kleidung zu verschwenden, und auch die Fassade seines Körpers konnte er nur noch mit Mühe ansehnlich erhalten. Eine Rasur wurde zu etwas, das er sich nicht mehr oft leisten konnte.
Ich begegnete ihm nur morgens. Wenn ich am Abend an den Plätzen unserer sekundenlang geteilten Sphären vorbeikam, hatte er sich anderen Revieren zugewandt, wohl beschäftigt mit der unendlichen Mühsal, die das Vorbereiten auf eine weitere Nacht bedeuten kann.
Der Verfall war ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr zu verbergen, und offenbar noch viel weniger aufhaltbar. Es kamen die Tage, an denen er nicht mehr schlurfte und keine Runden mehr drehte, sondern in einer Ecke saß und mit aller verbliebenen Kraft bemüht schien auszudrücken, dass er keine Almosen wollte. Ich weiß das, denn ich wollte ihm einmal eine Handvoll Münzen zustecken, errötend vor Scham, als er mich brüsk abwies. Es fällt mir heute noch schwer, daran zu denken.
Auch jetzt versuchte er nicht, Anschluss zu finden, an die, die seinen Weg schon gegangen waren, die ihm vielleicht Hinweise geben hätten können, welche Weggabelung wohin führte, oder wo man einmal ausruhen konnte vor der Gewalt der Ruhelosigkeit. Ich habe ihn nie ein Wort sprechen sehen. Das war ihm auch zu schwer geworden.
In der letzten Zeit war Theo in einer langen, nicht mehr zu gewinnenden Schlacht. Er lag in versteckten Ecken und Nischen der U-Bahn-Welt, und er hatte viele der anderen überholt, die schon vor ihm da gewesen waren. Ich sah den Momenten mit Furcht entgegen, in denen ich ihm begegnete. Er begegnete mir weniger denn je. Ein Versuch, eines Morgens die Aufsicht für den leblosen Mann zu interessieren, scheiterte. Die Rettung zu rufen wagte ich nicht. Ich glaube, so weit hatte ich ihn verstanden.
Theo hatte seine Geschichte schon erlebt und abgehakt, bevor ich ihn zum ersten Mal sah. Was war es gewesen, das ihn dazu gebracht hatte, die Neugierde auf sein Leben hintanzustellen? Der Verlust eines Menschen, einer Stelle, einer Illusion? Jede unserer Entscheidungen kann jeden Tag alles verändern. Manchmal scheint es, als hätten wir diese Möglichkeit nicht mehr. Und manchmal ist es so.
Mich hat Theo etwas gelehrt: mit seinem ganzen alles verweigernden Stolz, seines Lebens Tiefe alleine auszuloten, hat er mich dankbar gemacht für jeden seiner verleugneten Brüder, dem ich ab und zu etwas geben darf.
Seit einigen Wochen ist Theo nicht mehr da. Ich glaube nicht, dass er die Station gewechselt hat. Während in derselben Zeit meine Welt sich um Urlaubspläne und berufliche Aufgaben, um Zahnarztbesuche und die Wahl eines Restaurants drehte, war einer langsam vor meinen Augen davon gegangen.
„… aber was soll man machen?“ schloss Vincent van Gogh seinen letzten Brief an den Bruder Theo, bevor er dieses Leben verließ.